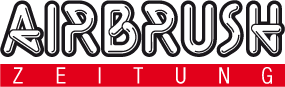Freier Maler und Grafiker (BBK) in Rellingen b. Hamburg. Als Folge eines Amerika-Aufenthaltes ab 1975 umfassendere Auseinandersetzung mit dem Airbrush. 1974-79 wissenschaftliches Studium als Versuch, soziologischen, historischen und didaktischen Aspekten der eigenen Tätigkeit Rechnung zu tragen. Veröffentlichungen in Katalogen, Fachpublikationen und Magazinen (auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden und Belgien). Beschäftigung mit Buchprojekten (bis 1985 haupts. Cover/Illustration). Seit 1983 Leitung von Airbrush-Seminaren für Profis (Deutschland/Schweiz), Autor eines 1990 erschienenen Arbeits- und Übungsbuches zum Thema Spritztechnik/Bildrealisation. 1988 intensiv mit der Entwicklung einer neuen Airbrush befasst. Originale in privaten und öffentlichen Sammlungen.
 Dass die Airbrush auch in der Grafik, also in dem Anwendungsbereich, welchem hier besondere Aufmerksamkeit gelten soll, schon früh Fuß fassen konnte, verdankte er sicherlich dem Erfolg jenes Peruaners, der als Zwanzigjähriger 1916 auf der Rückreise von Europa beschlossen hatte, in New York zu bleiben und der mit Hilfe des Airbrushs weltberühmt werden sollte: Alberto Vargas; „der Mann, der den GI’s zum Bewusstsein verhalf, dass in der Heimat mehr als nur Mutters Apfelkuchen auf sie wartete…
Dass die Airbrush auch in der Grafik, also in dem Anwendungsbereich, welchem hier besondere Aufmerksamkeit gelten soll, schon früh Fuß fassen konnte, verdankte er sicherlich dem Erfolg jenes Peruaners, der als Zwanzigjähriger 1916 auf der Rückreise von Europa beschlossen hatte, in New York zu bleiben und der mit Hilfe des Airbrushs weltberühmt werden sollte: Alberto Vargas; „der Mann, der den GI’s zum Bewusstsein verhalf, dass in der Heimat mehr als nur Mutters Apfelkuchen auf sie wartete…
Außer seiner Überzeugung, dass es ‚nichts auf dieser Welt gibt, was man mit einem schönen Mädchen vergleichen könne‘, bringt er nur seine Erfahrung als Fotoretuscheur aus Europa mit“ (Zitate aus Hans Hoyngs Aufsatz: „Mädchen, überall nur Mädchen“, Hamburg 1979).
Vargas war jedoch kein Airbrush-Purist, auch wenn die Spritztechnik besonders seine „Esquire“-Zeit prägte. Er bevorzugte die Aquarellmalerei und sah die Airbrush am liebsten erst dann zum Einsatz kommen, wenn eine schon zu mehr als dreiviertel fertige Pinselarbeit auf diese Weise noch ihren letzten Touch erhalten sollte. Eine darüberhinausgehende Nutzung der Spritztechnik war für ihn somit eher eine Art notwendiger Kompromiss, um schneller eine entsprechende Menge an Druckvorlagen in ausreichender Qualität bereitstellen zu können. Die Problematik, die eine solche Arbeitsweise nach Vargas‘ Ansicht mit sich bringt, liegt in der Gefahr, dass letztlich der Airbrush und nicht mehr allein der Ausführende das Endergebnis bestimmt, das (die) Dargestellte also an Wärme und Individualität verliert.
 1919 entsteht in Weimar mit dem Architekten Walter Gropius eine Kunstrichtung, die den uneingeschränkten Gebrauch der Airbrush zulässt: das Bauhaus. Hatte die freie Kunst den Spritzgeräten bis dahin ablehnend gegenübergestanden – mit der teilweise auch heute noch vorgebrachten Argumentation, dass ein Farbspritzapparat niemals in direkte Berührung mit dem Malgrund käme, die Technik den Künstler also seiner ‚Handschrift‘ berauben würde –, so war durch das erklärte Ziel des Bauhauses, eine Synthese zwischen Kunst und Ökonomie, Kreativität und Technologie, Ästhetik und Handwerk zu schaffen und damit die Unterscheidung zwischen freier und angewandter Kunst aufzuheben, der „Luftpinsel“ zum gleichwertigen Arbeitswerkzeug neben Pinsel und Bleistift geworden.
1919 entsteht in Weimar mit dem Architekten Walter Gropius eine Kunstrichtung, die den uneingeschränkten Gebrauch der Airbrush zulässt: das Bauhaus. Hatte die freie Kunst den Spritzgeräten bis dahin ablehnend gegenübergestanden – mit der teilweise auch heute noch vorgebrachten Argumentation, dass ein Farbspritzapparat niemals in direkte Berührung mit dem Malgrund käme, die Technik den Künstler also seiner ‚Handschrift‘ berauben würde –, so war durch das erklärte Ziel des Bauhauses, eine Synthese zwischen Kunst und Ökonomie, Kreativität und Technologie, Ästhetik und Handwerk zu schaffen und damit die Unterscheidung zwischen freier und angewandter Kunst aufzuheben, der „Luftpinsel“ zum gleichwertigen Arbeitswerkzeug neben Pinsel und Bleistift geworden.
Äußerungen von Friedrich Boldt, der im Gründungsjahr des Bauhauses mit der Herstellung seiner ‚Efbe-Spritzapparate‘ begann, reflektieren die Überlegungen jener Zeit: „Es ist überraschend festzustellen, wie viele Möglichkeiten dieses Instrument bei guter Routine in der Welt der Kunst hat…
…mit diesem vollkommenen Instrument können Effekte schöpferischer Art erzielt werden, welche in einer anderen Manier nicht zu erreichen sind. Selbstverständlich muss der Apparat von einem Künstler mit gewissen Fähigkeiten gehandhabt werden und nicht, wie viele glauben, dass der Apparat eine mechanische Erfindung ist, mit mechanischen Ergebnissen. Die mechanische Handhabung ist empfindlich für jede Nuance und zeigt sofort die Kunst des geschickten Arbeiters“. (Zitate aus: „EFBE-Chronik“.)
 Anfang der zwanziger Jahre hatte sich in Deutschland schon einiges auf dem Spritzgerät-Sektor getan. Einem 1955 erschienenen Aufsatz von Emil Brauer („Farb- und Lack-Spritzapparate: ihre Bedeutung für den Fotoretuscheur, Gebrauchsgrafiker und Plakatmaler“) zufolge kamen um 1900 die ersten Spritzapparate über die ‚Aerograph Company Ltd‘, London, nach Deutschland. In Berlin von einem Engländer namens King eingeführt, wurde dort eine ganze Weile auch der gleichnamige „King“-Spritzapparat – zuletzt von Plönsdorf – gefertigt. (Ob und inwieweit dieses Gerät in Lizenz gebaut wurde, ist leider nicht mehr bekannt.)
Anfang der zwanziger Jahre hatte sich in Deutschland schon einiges auf dem Spritzgerät-Sektor getan. Einem 1955 erschienenen Aufsatz von Emil Brauer („Farb- und Lack-Spritzapparate: ihre Bedeutung für den Fotoretuscheur, Gebrauchsgrafiker und Plakatmaler“) zufolge kamen um 1900 die ersten Spritzapparate über die ‚Aerograph Company Ltd‘, London, nach Deutschland. In Berlin von einem Engländer namens King eingeführt, wurde dort eine ganze Weile auch der gleichnamige „King“-Spritzapparat – zuletzt von Plönsdorf – gefertigt. (Ob und inwieweit dieses Gerät in Lizenz gebaut wurde, ist leider nicht mehr bekannt.)
 Im Jahre 1905 begann der Ingenieur Otto Heinrich in Leipzig mit dem Bau eines eigenen, patentrechtlich geschützten Retuschier-Spritzapparates. Eine augenfällige Besonderheit dieses Gerätes war die außerhalb und oberhalb des eigentlichen Gerätekörpers angeordnete Farbdüsennadel; diese Bauweise erlaubte es dem Anwender, die Nadel während der täglichen Spritzarbeit schneller herauszunehmen, sachgemäß ‚aufzupolieren‘ und wieder einzusetzen, als dies bei ausländischen Fabrikaten möglich war.
Im Jahre 1905 begann der Ingenieur Otto Heinrich in Leipzig mit dem Bau eines eigenen, patentrechtlich geschützten Retuschier-Spritzapparates. Eine augenfällige Besonderheit dieses Gerätes war die außerhalb und oberhalb des eigentlichen Gerätekörpers angeordnete Farbdüsennadel; diese Bauweise erlaubte es dem Anwender, die Nadel während der täglichen Spritzarbeit schneller herauszunehmen, sachgemäß ‚aufzupolieren‘ und wieder einzusetzen, als dies bei ausländischen Fabrikaten möglich war.
Zu den ausländischen Herstellern, die zu dieser Zeit bereits bekannt waren und die, wie die schon angesprochene „Aerograph Company‘ von Charles Burdick, Spritzapparate mit abgedeckter und in Längsrichtung durch den Airbrushkörper geführter Nadel fertigten, gehörten die amerikanischen Firmen Thayer & Chandler und Wold.
 Angaben über die Firmengeschichte von Thayer & Chandler zufolge war es dieser Hersteller, der 1891 – also noch zwei Jahre vor Burdick – den ersten patentierten Retuschier-Spritzapparat baute. Eine Schlüsselposition kam dieser Firma auch noch aus einem anderen Grunde zu: um die Jahrhundertwende war einer ihrer Angestellten der gerade in die USA eingewanderte Jens A. Paasche. Paasches Anstellung bei Thayer & Chandler dürfte jedoch trotz der „Kettenreaktion“, die sie auslöste, nicht allzu lang gewesen sein, denn bevor der gelernte Büchsenmacher 1904 mit dem Aufbau der ‚Paasche Airbrush Company‘ begann, war er schon als Mitbegründer der ‚Wold Airbrush Company‘ in Erscheinung getreten. Die Partnerschaft Wold-Paasche zerbrach aber nach rund einem Jahr, und Paasche machte sich mit dem Erlös aus seinen ‚Wold‘-Anteilen vollends selbständig. Chicago, die Heimat dieser drei Firmen, wurde durch diese Entwicklung zum Zentrum des amerikanischen Airbrushbaus; auf den jüngsten der dort ansässigen und international bekannten Herstellern, die Badger Airbrush Company, wird in anderem Zusammenhang noch einzugehen sein.
Angaben über die Firmengeschichte von Thayer & Chandler zufolge war es dieser Hersteller, der 1891 – also noch zwei Jahre vor Burdick – den ersten patentierten Retuschier-Spritzapparat baute. Eine Schlüsselposition kam dieser Firma auch noch aus einem anderen Grunde zu: um die Jahrhundertwende war einer ihrer Angestellten der gerade in die USA eingewanderte Jens A. Paasche. Paasches Anstellung bei Thayer & Chandler dürfte jedoch trotz der „Kettenreaktion“, die sie auslöste, nicht allzu lang gewesen sein, denn bevor der gelernte Büchsenmacher 1904 mit dem Aufbau der ‚Paasche Airbrush Company‘ begann, war er schon als Mitbegründer der ‚Wold Airbrush Company‘ in Erscheinung getreten. Die Partnerschaft Wold-Paasche zerbrach aber nach rund einem Jahr, und Paasche machte sich mit dem Erlös aus seinen ‚Wold‘-Anteilen vollends selbständig. Chicago, die Heimat dieser drei Firmen, wurde durch diese Entwicklung zum Zentrum des amerikanischen Airbrushbaus; auf den jüngsten der dort ansässigen und international bekannten Herstellern, die Badger Airbrush Company, wird in anderem Zusammenhang noch einzugehen sein.
„Dies aus Amerika stammende Instrument zur Herstellung von Tuschezeichnungen und zum Retuschieren ist in kurzer Zeit zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Reproduktionstechnik geworden, in welcher die Positiv-Retusche nunmehr die weitgehendste Anwendung findet Es dient dem Zeichner zur raschen Herstellung von feinsten Tuschezeichnungen und zum Schattieren von Flächen, dem Lithographen ist es ein nützliches Instrument bei der Herstellung von Schwarz- und Farbplatten auf Papier und direkt auf Stein, und für den Photographen und Retuscheur erscheint es nach Gebrauch unentbehrlich für einfache sowie künstlerische Retusche von Negativen und Vergrößerungen, von Originalen für Reproduktionszwecke, von Silber-Lichtdrucken usw.“
 Ein solches Zitat (nach einem Katalog eines deutschen Reproduktionsgeräteherstellers etwa um 1910) erlaubt unter anderem erste Rückschlüsse auf den Zeitpunkt, zu dem man hierzulande allgemein erkannt hatte, dass die anwendungsspezifischen Vorteile der Retuschier-Spritzapparate über die Fotoretusche ‚um ihrer selbst willen‘ hinaus auch für die druckvorbereitende Bildherstellung von besonderer Bedeutung sein würden. Prospektmaterial für deutsche Spritzgeräte, welches offensichtlich aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammt (eine genauere Datierung ist in der Regel leider kaum noch möglich), stellt für die jeweiligen Apparate die Einsatzgebiete ‚Positivretusche‘ und ‚Herstellung von Klischees (Autotypien)‘ gleichwertig nebeneinander heraus. Diese arbeitstechnische Diversifikation, vor deren Hintergrund die Entwicklung deutscher Spritzapparate mit einer oberhalb des eigentlichen Gerätekörpers angeordneten Farbnadel zu sehen ist, wird in ihrer Bedeutung leicht ersichtlich, wenn die Materialien, die bei den jeweiligen Aufgaben zu versprühen sind, speziell unter dem Aspekt ihrer Zusammensetzung betrachtet werden.
Ein solches Zitat (nach einem Katalog eines deutschen Reproduktionsgeräteherstellers etwa um 1910) erlaubt unter anderem erste Rückschlüsse auf den Zeitpunkt, zu dem man hierzulande allgemein erkannt hatte, dass die anwendungsspezifischen Vorteile der Retuschier-Spritzapparate über die Fotoretusche ‚um ihrer selbst willen‘ hinaus auch für die druckvorbereitende Bildherstellung von besonderer Bedeutung sein würden. Prospektmaterial für deutsche Spritzgeräte, welches offensichtlich aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stammt (eine genauere Datierung ist in der Regel leider kaum noch möglich), stellt für die jeweiligen Apparate die Einsatzgebiete ‚Positivretusche‘ und ‚Herstellung von Klischees (Autotypien)‘ gleichwertig nebeneinander heraus. Diese arbeitstechnische Diversifikation, vor deren Hintergrund die Entwicklung deutscher Spritzapparate mit einer oberhalb des eigentlichen Gerätekörpers angeordneten Farbnadel zu sehen ist, wird in ihrer Bedeutung leicht ersichtlich, wenn die Materialien, die bei den jeweiligen Aufgaben zu versprühen sind, speziell unter dem Aspekt ihrer Zusammensetzung betrachtet werden.
(wird fortgesetzt)